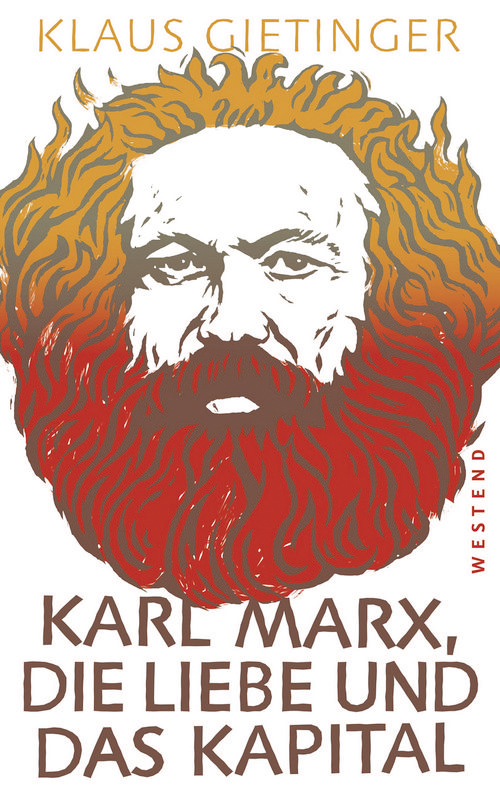
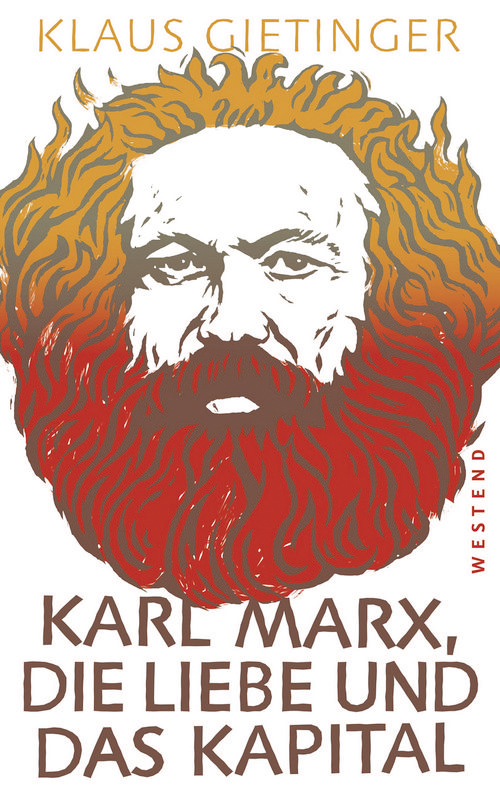
Ein unglaubliches Leben: Karl Marx und die Seinen
Klaus Gietingers Roman „Karl Marx, die Liebe und das Kapital“
Karl Marx, der ungeliebte Sohn der Stadt Trier, besitzt auch 200 Jahre nach
seiner Geburt und 135 Jahre nach seinem Tod noch eine ungeheure Faszinationskraft.
Er hat das Denken in seiner Zeit und die Welt nach seiner Zeit umgepflügt
und Bataillone von Wissenschaftlern und Philosophen auf den Plan gerufen,
ihn entweder zu widerlegen oder einzugemeinden. Das Jubiläumsjahr 2018
legt Zeugnis davon ab, indem es mit einer unüberschaubaren Flut von Publikationen
aufwartet, die Marx historisieren oder aktualisieren wollen, die ihm ihre
Aufwartung als großer Theoretiker, aber schlechter Praktiker machen,
die ihn anklagen ob der Gewalt, die das kommunistische Menschheitsexperiment
in der Sowjet-Union und anderswo begleitet hat, oder die ihn in Schutz nehmen
und die Oktoberrevolution als eine Betriebsunfall der Geschichte hinstellen,
mit der der ‚Demokrat‘ Marx nichts zu tun hätte. Summa summarum
lassen sich aus der ‚geistigen Überproduktion‘ anlässlich
seines zweihundertsten Geburtstag drei Haltungen herausdestillieren: eine
affirmative, die sich nur noch wenige einzunehmen trauen, nämlich diejenigen,
für die die Dummheit der Kommunisten kein Argument gegen den Kommunismus
ist, eine kritische, die versucht, Marxens Aktualität für die Erklärung
der modernen Zeitläufte nachzuweisen und eine vereinnahmende, die ihn
zum einen immunisiert gegen die Folgen seiner ‚Lehre‘ und zum anderen
ihm den revolutionären Stachel nimmt und versucht, ihn zu versozialdemokratisieren.
Aus der Art dieser Rezeptionsmuster schlägt das Buch von Klaus Gietinger.
Er, der im Hauptberuf Filmemacher ist, geht das belletristische Wagnis ein,
das stürmische persönliche, geistige und politische Leben von Marx
in eine Romanhandlung zu überführen. Und zwar nicht in irgendeine
Romangattung, sondern in ein Genre, das man mit Marx zunächst gar nicht
in Verbindung bringt: den Liebesroman. Genau genommen erzählt der Autor
von den emotionalen, psychischen und körperlichen Beziehungen zwischen
historischen Personen, sei es die tiefe Liebe, die zwischen dem Bürgersohn
Marx und der vier Jahre älteren Adligen Jenny von Westphalen über
ein ganzes Leben hinweg bestand, sei es die rührende und oft vergebliche
Sorge des Pater Familias Marx um seine Kinder, sei es die innige Freundschaft
zwischen dem immer am Hungertuch nagenden Marx und dem Kapitalistensohn Engels,
sei es die Vielweiberei Engels und sein uneheliches Verhältnis zur Fabrikarbeiterin
Mary Burns, sei es die Treue, mit der die Haushälterin Lenchen Demuth
auch dann noch zur Familie stand, als Marx nach seinem ‚Fehltritt’
ihren gemeinsamen Sohn Frederik verleugnete, seien es die vielen Feind-Freundschaften,
die Marx mit seinen intellektuellen Zeitgenossen pflegte, sei es das Verhalten
von Jennys Halbbruder Ferdinand, der im Auftrag des preußischen Staats
Marx gnadenlos verfolgen ließ, aber im letzten Moment aus Sympathie
für Jenny auch abdrehen konnte.
Freilich ist die Kategorie ‚Liebesroman‘ zu dürr, um das Werk
von Gietinger angemessen würdigen zu können. Gietinger interessiert
das ganze Leben von Marx und dazu gehört natürlich genuin seine
geistige Produktion. Wie sein intellektuelles Wirken, seine Lebenswelt, sein
Liebesleben, seine politischen Interventionen ineinander verwoben sind, dieser
Riesenaufgabe versucht der Autor mit einer Methode gerecht zu werden, die
ich literarische Bricolage nennen möchte. Sie umfasst nicht-fiktionale
Texte etwa bei der Wiedergabe von Zitaten aus den Werken von Marx/Engels,
fiktionale Spielszenen und Fragmente reiner Romanerzählung. Sie ähnelt
damit der filmischen Doku-Fiction, also der mit Spielszenen angereicherten
Dokumentation und von daher kann man von Gietingers Werk durchaus als Dokumentarroman
mit theatralen Elementen sprechen. Dazu passt, dass im Roman die Erzählperspektive
ständig wechselt. Die Geschichte wird erzählt vom Ich-Erzähler
Friedrich Engels, vom auktorialen Erzähler (Autor), aus der Sicht von
der Marx-Tochter Tussy (Eleanore) und daneben gibt es noch die Perspektiven
von neutralen und personalen Erzählern. Die verschiedenen Erzählperspektiven
wirken dabei wie verschiedene Kameraperspektiven im Film.
Der Kunstgriff, den Gietinger anwendet, besteht darin, dass er am Krankenbett
von Engels ihn und Tussy über das Leben des ‚Mohr‘ und der
Seinen erzählen und sinnieren lässt. Diese Ausgangskonstellation
ist selbst wieder Teil einer Geschichte, nämlich des Versuchs der deutschen
Sozialdemokratie, sich der eigentlich Tussy und ihrer Schwester Laura zustehenden
Hinterlassenschaft von Marx zu bemächtigen. In gewisser Weise bildet
diese Erbschleicherei der Sozialdemokraten, die Engels letztlich nicht abwehren
kann, die Rahmenhandlung des Romans. Engels, der weiß, dass sein Leben
zu Ende geht, fühlt sich bemüßigt, Tussy alle Seiten des Lebens
ihres Vaters nahezubringen und Tussy färbt diese Erzählungen mit
ihren Erinnerungen und Deutungen. Auf diese Weise gelingt es dem Autor, ein
pittoreskes Panorama historischer Ereignisse und persönlicher Erlebnisse,
einen Reigen an ‚menschlich allzu menschlichen‘ Begebenheiten zu
zeichnen und gleichzeitig basale Einsichten in das Marx’sche Denken zu
vermitteln. Engels und Tussy schlagen das Buch eines unglaublich reichen und
überfüllten Lebens auf und arbeiten sich darin vom Liebeswerben
um Jenny bis zum Tod von Marx vor. Marxens Leben tritt uns in kurzen prägnanten
Szenen gegenüber, die alle wesentlichen Stationen und Abschnitte seines
Wirkens enthalten. Die Sprache, die der Autor dabei einsetzt, ist klar, unprätentiös,
verständlich, auch wenn er - wie damals üblich - mit englischen
und französischen Einsprengseln arbeitet. Gietinger umschifft souverän
die Untiefen des Genres ‚Liebesroman‘; es wird nie schwülstig,
romantisch oder gar schlüpfrig, dafür manchmal ganz schön deftig
und ordinär.
Was in den Kurzszenen, die die Person Marx, seine Familie, das intellektuelle
und politische Milieu, in dem er agierte, die Lebenswelten, in die er hineingeriet,
ausleuchten, besonders haften bleibt, ist ein enormer Widerspruch, der das
Leben von Marx durchzog. Er hat die ‚menschliche Tragödie‘
am eigenen Leib erlebt: Flucht (nach Paris vor der deutschen Enge), Vertreibung
(aus Köln, Paris und Brüssel), Verfolgung (durch die preußische
Geheimpolizei), bittere Not, Krankheiten aller Art, den Tod von vier Kindern.
All das würde locker ausreichen, um in Resignation und Depression abzugleiten.
Aber das Unglück, das ihn so oft heimgesucht hat, hat ihn nicht von seinem
prometheischen Vorhaben abgehalten, die Welt aus den Angeln zu heben und Werke
zu schaffen, die noch viele Generationen nach ihm in ihren Bann schlagen.
Wer so etwas vollbringt, ist in aller Regel kein einfacher Mensch. Der Roman
von Gietinger bietet dafür reichlich Anschauungsmaterial. Marx wird darin
nicht heroisiert, sondern menschlich gemacht. Die Maßlosigkeit, die
er dem Kapital attestiert hat, war auch ihm eigen: im Denken, wo er keinen
Besseren neben sich ertragen konnte, im Geld ausgeben, wo er (und Jenny) beständig
über seine (ihre) Verhältnisse lebte(n) und damit ein dauerndes
Rendezvous mit dem Elend einging(en), im politischen und intellektuellen Streit,
wo er seine Gegner abkanzelte, der Lächerlichkeit preisgab und regelrecht
‚vernichtete‘, im Schreiben, wo ihn sein Perfektionismus lähmte.
Marx mutete seiner Umgebung viel zu, soviel wie auch sich selber, was ihn
häufig an den Rand der Erschöpfung, in die Verzweiflung und Krankheit
führte. Er, der die sozialste Sozialtheorie der Welt entwickelt hat,
war oft unfähig zur Empathie und nur auf sein Leid fixiert, was um ein
Haar die Freundschaft zu Engels in Mitleidenschaft gezogen hätte, als
Mary Burns starb und Marx in seiner Antwort auf diese Benachrichtigung sich
in Selbstmitleid erging. Ganz zu schweigen von seinem Verrat an seinem unehelichen
Sohn Freddy, den Lenchen Demuth zu einer Trinkerfamilie weggeben musste. Freddy
war trotz dieser schmählichen Behandlung später einer der Treuesten,
der ganz im Sinne von Marx gearbeitet hat und einer der Begründer der
englischen Labour Party war.
Gietinger beschreibt diese Verhaltensweisen von Marx ohne moralinsauren Unterton,
ohne psychologisierendes Beiwerk. Er mischt sie seinen anderen Charakterzügen
wie seiner sprichwörtlichen Großzügigkeit, seiner anteilnehmenden
Liebe für die Kinder, seiner Treue für Jenny bei und erzeugt so
ein realistisches, ein menschliches Bild des zur Ikone gewordenen Marx.
Ein anderer spannender Eindruck, den der Roman hinterlässt, ist die ‚Reifung‘
von Marx. Schon in seiner Sturm- und Drangzeit gehörte er politisch nicht
zu den Abenteurern, die wie Weitling, Herkenrath u.a. mit Waffen gegen den
absolutistischen Staat losschlagen wollten und sich nur blutige Abriebe holten.
Später, nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution verlegte
er sich auf die wissenschaftliche Arbeit im British Museum, mit der er das
Bewegungsgesetz des Kapitalismus herausfinden und die herrschende ökonomische
Lehre umstürzen wollte. Zwar war er auch in der langen Zeit der Abfassung
des ersten Bandes des Kapitals politisch unterwegs u.a. bei der Gründung
der Ersten Internationale oder durch seine journalistische Arbeit bei der
New York Daily Tribune, doch man wird im Roman den Eindruck nicht los, dass
Marx das Proletariat und seine Vertreter als nicht reif für die Revolution
einschätzt. Nachdem durch die Pariser Kommune die Hoffnung auf die baldige
Machbarkeit des Kommunismus noch einmal aufgeflackert ist, begräbt Marx
sie spätestens mit dem Gothaer Programm der vereinigten deutschen Sozialdemokratie,
an dem er kein gutes Haar lässt. Könnte es sein, dass Marx die Arbeiten
an seiner ökonomischen Theorie deshalb so vorangetrieben hat, weil er
die politische Praxis seiner Weggefährten als wenig weiterführend
betrachtete?
Gietingers Roman ist gerade auch wegen der theoretischen Einschübe über
Marxens Werk ein Lesevergnügen. Man schmunzelt über den missratenen
Versuch des Frauentausches, freut sich diebisch über die tolpatschigen
Spitzel, vor allem Stieber, runzelt die Stirn ob der antisemitischen Anwandlungen
des zum Protestantismus konvertierten Juden Marx, man leidet mit den Eltern,
deren Kinder fast wie die Fliegen sterben, es verschlägt einem die Sprache
ob der Schilderung der Zustände im „Juggernaut-Rad des Kapitalismus“
in Manchester, man wundert sich über Jenny, die aus Standesgründen
Mary Burns zurückweist, fühlt sich ganz nah bei Marx, als er über
dem Studium der Herr-Knecht-Dialektik bei Hegel buchstäblich zusammenbricht,
man lacht laut auf, als Lenchen Demuths Betrachtungen zum Kochtopf, der macht
was er will, in den Fetischcharakter der Ware münden, es stockt einem
der Atem, wenn der Autor die Abfassung des Kommunistischen Manifests und die
Fieberträume von Tussy parallel schaltet und die Marx-Tochter vorausahnen
lässt, welchen Wahnsinn der Kapitalismus noch hervorbringen wird, man
staunt über eine andere frivole Parallelschaltung von Marxens Reflexionen
über Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse und Engels
produktiver Arbeit im Bett einer Hure.
Kurzum: Gietinger hat einen leichten und anspruchsvollen Roman geschrieben, der den Marxunkundigen schelmisch und verschmitzt auf die Fährte seines Denkens führt und der für den Marx-Kundigen reichhaltigen Stoff aus dem prallen Leben eines gar nicht vergeistigten Großdenkers bereit hält, der i.d.R. unter die Aufmerksamkeitsschwelle der Linken fällt. Da kann man es ihm auch nachsehen, dass sich kleinere Ungenauigkeiten in der Vermittlung der Theorie eingeschlichen haben, wie die Sache mit der Religion, die eben nicht Opium fürs Volk, sondern Opium des Volkes ist, ein Unterschied ums Ganze oder die andere Sache mit dem Sein und dem Bewusstsein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein nur in einer verkehrten Welt, die kein bewusstes Sein zulässt. Marx ist der beste Beweis für die Kraft des Bewusstseins, sich über das Sein zu erheben und es in seiner Verkehrtheit zu durchschauen.
Gietinger, Klaus: „Karl Marx, die Liebe und das Kapital“, Westend Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2018, 351 S., 22 Euro