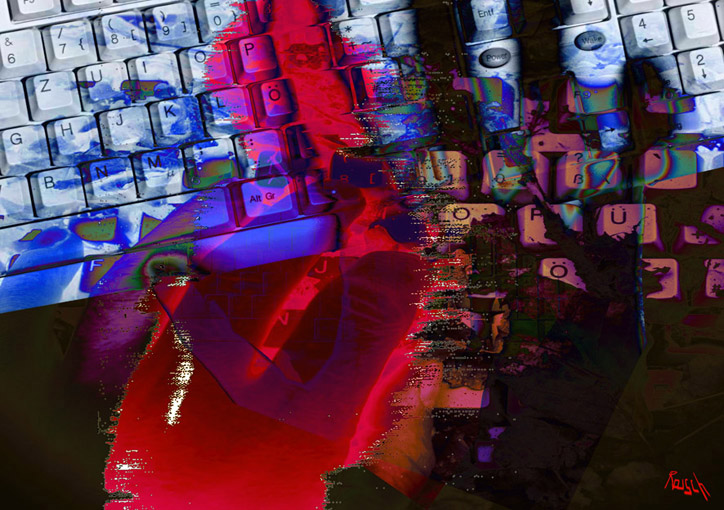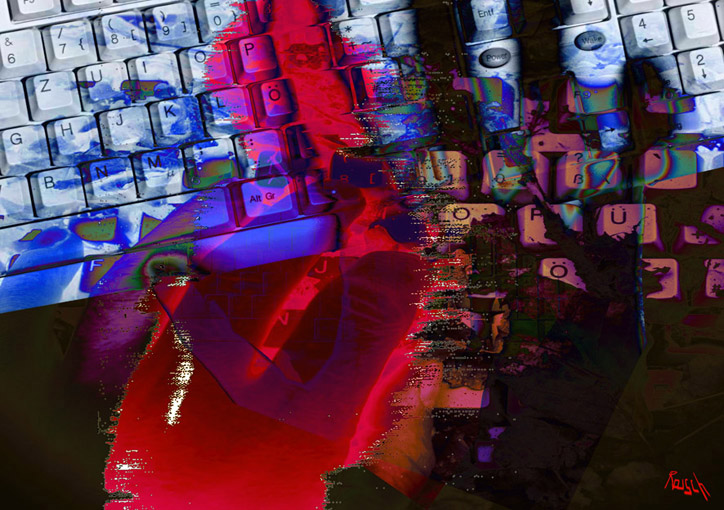
Neuer Saarland-Krimi – Mörderische Zeugnisse
23. Juli 2011
Die saarländische Krimiautorin
Elke Schwab berichtet in „Galgentod auf der Teufelsburg“ von schlechten
Noten, die lange und nachhaltig wirken
Conte Verlag
Buchvorstellung von Stefan Gleser
Irgendwann entscheidet es sich, und sei es beim Abitur, ob man Humankapital
oder Personalchef wird. Verständlich, dass ein Lehrer, der einem den
Durchschnitt versaut, nicht gerade beliebt ist. Aber im Falle des Bertram
Andernach wurde übertrieben. Der Pädagoge für Deutsch baumelt
nämlich im Lichthof eines Gymnasiums in Saarlouis und wird von seinen
Schülern eifrig fotografiert. Als noch ein weiterer Lehrkörper,
die Historikerin Mathilde Graufuchs, das Pensionsalter verfehlt, läuft
das aus Saarbrücken geholte Ermittlungsteam auf vollen Touren.
Im „Galgentod auf der Teufelsburg“ schickt Elke Schwab ihr Stammpersonal
auf Tätersuche. Allen voran der Leiter der Dienststelle Jürgen Schnur.
Von seinem Alter her ist er, was sich später als Vorteil herausstellen
wird, ein Vermittler. Die Laboranalysen, die Suche im Internet, sogar ein
Handy ist er durchaus bereit zu akzeptieren. Aber er kann sich an die Zeit
erinnern, wie sein längst pensionierter Kollege Kullmann sich vorstellte,
Verdächtiger zu sein, und klug, aufmerksam und voll Verständnis
bei der Vernehmung schwieg, zuhörte und scheinbar beiläufig fragte.
Schnurs Mitstreiter Erik Tenes, dann doch erheblich jünger, tröstet
sich mit einem teuren BMW über das Ein-Zimmer-Appartement, die gescheiterte
Ehe und die Strafversetzung wegen Suffs hinweg.
Die üblichen Verdächtigen bleiben gleich auf der Strecke. Die Opfer
schnappten keinem Kollegen die Beförderung weg noch waren sie in dramatische
Beziehungskisten verstrickt. Was die beiden Lehrer verband waren Herrenreiterscherze,
eine Art der Ironie von oben herab, Witze, die sich im Offizierscasino wohl
fühlen. Es genügte nicht, dass der Schüler unter einer miesen
Note litt. Er sollte unbedingt blossgestellt und verachtet wurden. Schlechte
Arbeiten wurden am „Schwarzen Brett“ veröffentlicht. Wenn
die Polizisten die Graufuchs befragten oder Andernachs Korrekturen durchlasen,
kam´s ihnen vor, als wollten die Pädagogen die Aufbruchsstimmung
ihrer Jugend, die 60er Jahre, denunzieren.
Eine etwas abstossende Mischung, ein schneidig-forsches Bildungsbürgertum
steht stramm im Lehrerzimmer und salutiert vor Fakten. Nur im Kopf des grossen
Trinkers und Mathepaukers Günter Laug flammt manchmal die Erkenntnis
auf, dass Unterricht mal was anderes gewesen könnte. Dann will er den
Schülern erzählen, dass die Abstraktion der Zahlen aus kühler
und kalter Kunst entstanden sei. Aber die Klasse weidet sich an seiner Sucht
und rächt sich für all das, was die anderen Lehrer ihr angetan haben.
Ein Grund für Laug in der Pause in den Lagerraum der Turnhalle zu schlurfen
und sich wieder ein Bier rein zu ziehen. Für Nachschub sorgt der Hausmeister
Ernst Plebe, im wahrsten Sinne des Wortes ein Pedell alter Schule. Bei ihm
ist eine Flasche Bier, wie Laug zu loben nicht umhin kann, noch ein halber
Liter. Würde Plebe sich school facility manager nennen, gäb´s
gewiss nur Premiumplörre aus dem Fernsehen im Stubbiformat
Die Ermordeten sind noch nicht beerdigt, da wird in den Gartengaststätten
wieder getrunken und gelacht; die Rentner machen ihre Ausflüge und die
Schüler poussieren. Saarlouis, die kleine Stadt, ist gleichgültig.
Waren die Lehrer so verhasst, sind wir so abgestumpft? Oder so klug lieber
an die Lebenden statt an die Toten zu denken? Schnur weiss es nicht so recht
und grübelt ziellos vor sich hin.
Inmitten des Kollegiums hockt gross und grau die Angst: Wer ist als nächster
dran? Andererseits scheint die Mördersuche, nachdem Kollegen und Bekanntschaften
nicht mehr in Frage kommen, reine Routine zu sein. Es muss ein früherer
Schüler gewesen sein, der sich gekränkt fühlte und aus nachtragender
Verbitterung die Taten begann. Dann mal her mit dem genetischen Fingerabdruck.
Auf dem Kommissariat vor Schnur sitzt müde und eingefallen Fred Recktenwald,
der es am geachteten Max-Planck-Gymnasium nicht bis zur mittleren Reife schaffte.
Schnur zweifelt, dass er in diesem Mann, an dem „alles verloren“
wirkt, der mit gebückten Schultern und gesenkten Kopf vor ihm hockt,
jemals Spuren von Energie, Planung und Härte finden wird, die für
einen Mord unerlässlich sind. Nur Schweigen und dabei sein, bis der Recktenwald
von sich aus anfängt zu reden. Da platzt Dieter Forseti, der Vorgesetzte
hinein, der dynamische Talkshowschwätzer und quasselt los von Motiv,
Kausalkette und Analyse. Das sind genau jene hochfahrenden, keinen Widerspruch
duldenden Worte, die Recktenwald in der Schule hörte, und jene sprachen,
die ihm das Abitur vermasselten und in den grossen Villen wohnen. Sofort kapselt
Recktenwald sich in seine Welt ein. Bedrückt, nicht weil er blamiert
wurde, sondern einen wichtigen Informanten verlor, geht Schnur aus dem Zimmer.
Er entsinnt sich eines alten Kollegen, der sich lieber auf Einfühlungsvermögen
und Atmosphäreschnuppern verlässt, denn auf DNA und Datenabgleich……..
Elke Schwab
Galgentod auf der Teufelsburg
Conte Verlag, Saarbrücken, 2011, Krimi 26
320 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-941657-39-7
Preis 12,90 €
Juli
2011 Ronny Blaschke beschreibt in seinem
Buch „Angriff von Rechtsaußen“ wie Nazis den Fussball infiltrieren
Verlag: Die Werkstatt
Buchbesprechung von Stefan Gleser
Vor dem Fußballspiel Österreich – Deutschland randalierten
Rotten von Hooligans in Wien und zeigten den Hitlergruss. Die Öffentlichkeit
reagierte in vorgestanzten Mustern. Wohlfeile Empörung, Distanzierung
und möglichst schnell vergessen. Als sei Rechtsradikalismus im Fussball
eine „lose Folge“ von Erscheinungen, die aus dem Nichts auftauchen
und spurlos wieder verschwinden. Dabei setzen fern der grossen Stadien die
Rechten zum Überfall auf die Amateurvereine an. Ronny Blaschke, vielfach
ausgezeichneter Sportjournalist, sammelte dafür in seinem Buch „Angriff
von Rechtsaußen“ zahlreiche Belege. Die Methoden der Nazis sind
vielfältig: Mit der Zaunlatte gegen Zuschauer, Ehrenamt, Vereinsgründung,
Netzwerke im Internet. Deshalb die Vielfalt der Wiedergabe: 24 Kapitel, die
unabhängig von einander gelesen werden können, die Reportage und
das Interview, der bekannte Profi und der unauffällige Schiedsrichter.
Wenn´s darum geht den Alltag zu erobern, sich in die Falten der Gesellschaft
zu schmiegen, dann wird Fussball nicht nur wegen seiner Popularität gebraucht.
Die bei Mannschaftssportarten übliche Hierarchie und ein starres Regelwerk
mit Befehl, Gehorsam und Bestrafung, so der Soziologe Gerd Dembowski, seien
für den autoritären Charakter attraktiv. Nach Ansicht des Gewaltforschers
Wilhelm Heitmeyer, sind Augenblicke in denen Fussball weltoffen und tolerant
leuchtet, nur ein kurzer Rausch. Frankreich ist, nachdem eine kunterbunte
Truppe 1998 den Weltmeistertitel holte, nicht liberaler und menschenfreundlicher
geworden. Und in Deutschland habe der lockere und entspannte Partypatriotismus
bei der WM 2006 den Fremdenhass genährt.
In Leipzig sah sich Blaschke die Praktiken der Rechten genauer an. Erfolgreichster
Verein vor Ort ist die Lokomotive. In den achtziger Jahren stand sie im Finale
des Europacups der Pokalsieger. Dem Verfall der DDR folgte der Absturz des
Vereins. Die Lok ging Pleite, wurde neu gegründet und startete in der
untersten Liga. Man war auf jedes Mitglied, jeden Cent angewiesen und nicht
wählerisch. Darin erkannten die Nazis ihre Chance. Die Fangruppe „Blue
Carps“ wurde zur rechten Kerntruppe umgeschmiedet und in der NPD-Zentrale
gedrillt. Anhänger von Chemie Leipzig und des antirassistischen Roter
Stern Leipzig brutal überfallen. Ein Kandidat der Rechten warb bei der
Kommunalwahl mit seinem Engagement für die Lok. Dazu eine Fan- und Jugendarbeit
von der akzeptierenden Art, die Rosen auf den Weg streut. Die Lok distanziert
sich von den Nazis und spricht Hausverbote aus. Dabei nutzen die Rechtextremisten,
wie ein Anhänger des Chemie Leipzig beobachtet, längst neue Formen
der Verständigung: „Die Fanszene wird subtil unterwandert, die
Rekrutierung erfolgt informell über Social Communities im Internet. Die
Bewegung hat dazugelernt. Sie hat sich in Zonen breitgemacht, die der Verein
und die Polizei kaum kontrollieren können.“
Während der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien lud der DFB extra
den Altnazi Hans-Ulrich Rudel ein. Der ehemalige Präsident Gerhart Mayer-Vorfelder
sülzte deutschnational. Unter Theo Zwanziger, mit dem sich Blaschke lange
unterhielt, vollzog der Fussballbund eine überraschende, tiefgreifende,
dem Zeitgeist widersprechende Wandlung. Zwanzigers Mutter war eine Gegnerin
des Naziregimes. Ihrem Mann, der an der Front stand, schrieb sie lange Briefe.
Sie versuchte ihm, so weit es die Vorsicht gegenüber der Zensur zu liess,
den NS-Staat als etwas Schändliches zu erklären, ihm zu erläutern,
dass er nicht für eine gerechte Sache kämpfe. Inmitten eines strammkonservativen
Umfeldes, die rheinland-pfälzische Provinz, Juristerei, DFB-Funktionäre,
die Stahlhelm-Fraktion innerhalb der CDU, bewahrte sich Zwanziger einen Grundgedanken
seiner Erziehung, das sich solch ein Krieg, wie der vergangene, nicht wiederholen
darf. Es muss ein langwieriger Prozess gewesen sein, den DFB von der Selbstverständlichkeit
zu überzeugen, dass Fussballer zuweilen auch Juden, Sinti oder Ausländer
sind oder Männer lieben. Heute ist der DFB bei der Internetseite „Netz
gegen Nazis“ dabei und schreibt einen Preis zur Erinnerung an Julius
Hirsch, einen von den Nazis ermordeten Nationalspieler aus.
Im Gewand des korrekten Ehrenamtlichen, der seinen freien Sonntag opfert
und sich auch für Spiele der C-Klasse nicht zu fein ist, betritt der
Lüdenscheider Schiedsrichter Stephan Haase den Rasen. Nur schade, dass
er Mitglied der NPD ist und jahrelang der inzwischen verbotenen „Nationalistischen
Front“ angehörte. Über Haase wurden nie Klagen laut, dass
er ausländische Spieler benachteilige. Seine Taktik, wenn Haase so unparteiisch
pfeift, dann kann die NPD nicht so schlimm sein, wie es in der Zeitung steht,
ist also bislang aufgegangen. Andere engagieren sich aus Spass am Sport, bei
Haase ist der Wunsch spürbar, für zwei Stunden dem Paria-Status
zu entkommen und sich respektiert in der Mitte der Gesellschaft zu finden.
Satt, zufrieden und fachwerkgeschmückt liegt Hildburghausen in den Hügeln
des Thüringer Waldes. Moscheen, viele Ausländer oder hohe Arbeitslosigkeit
findet man hier nicht. Es braucht keinen Vorwand um Nazi sein, man ist es
aus Überzeugung wie Tommy Frenck. Im Gespräch mit Ronny Blaschke
definiert er sich wie viele seinesgleichen sofort als Opfer. In der Schule
gab man ihm nämlich keine Nazibücher. Zwar hängen an jedem
Kiosk „Landserheftchen“ und „Nationalzeitung“ aus,
trotzdem schildert Frenck seine Suche nach Literatur, die Krieg und Faschismus
verherrlicht, wie ein Dissident der sich konspirativ Samisdatschriften beschafft.
Bundesweit Furore machte Frenck als er in die Freiwillige Feuerwehr seines
Heimatortes Schleusingen eintreten wollte, und diese mit einer kollektiven
Rücktrittsdrohung antwortete. Danach wurde das verträumte Örtchen
Schleusingen zur „Frontstadt“ erklärt.
Frenck zog weiter nach Hildburghausen. Dort entfaltete sich eine fieberhafte
rechte Aktivität: Vorträge, beschmierte Stolpersteine, die an ermordete
jüdische Bürger Hildburghausens erinnern, zerschlagene Fensterscheiben
des Büros der Linkspartei, Überfälle auf Punks, eine freie
Kameradschaft, Konzerte, Infostände, ein rechtes Klamottengeschäft,
NS-Parolen hingemalt und die Gründung des Sportvereins „Germania
Hildburghausen. Irgendwann schaffte Frenck nicht mehr den Spagat zwischen
„bürgernaher und sozialer“ Schminke und den jungen, auf Randale
erpichten Neonazis vom Bolzplatz. Es kam zum Zerwürfnis mit der NPD,
die den „sächsischen Weg“ bevorzugte, also dem netten Nazi
von nebenan, der auch mal bei den Hausaufgaben hilft, weil angeblich zu viele
Kopftuchmädchen in der Klasse sind. Bei den Kommunalwahlen drapierte
sich Frenck noch einmal modisch schick haidermässig und errang mit seinem
„Bündnis Zukunft“ einen Sitz im Kreistag.
Woher rührt Frencks forsches Selbstbewusstsein, dass er den Bürgermeister
seines Wohnortes ohne weiteres mit „Dein Haus wird brennen“ bedroht?
Der ist immerhin gross und kräftig gebaut, ein gestandener Rettungsschwimmer
und zumindest als Vorsitzender des Traditionsvereins FSG über die Parteien
hinweg beliebt. Und Honoratioren zu achten, lernt man in der Provinz von klein
auf. Frenck kann sich einer abwiegelnden Neutralität sicher sein, die
seine Handlungen relativiert und mildert. Die Polizei interpretiert gewalttätige
Angriffe der Nazis häufig als Rangeleien unter Jugendlichen und Eltern
sehen im Abgleiten ihrer Kinder in die rechte Szene eine altersgemässe
Opposition. . Frenck ist gewiss keiner, der mit atemloser Neugier am Schreibtisch
sitzt und sich Notizen zu Gramsci macht. Aber in seinen besten Momenten rät
ihm ein schlechter Geist, ihn anzuwenden.
Was sind das für Zeiten, wo man sich mit Fussballfreunden türkischer
Muttersprache oder jüdischer Religion nicht über Doppelpass und
Kopfball unterhält, sondern über körperliche Angriffe, Hassgesängen
auf den Rängen und Polizeischutz. Blaschke war bei Türkyemspor Berlin
und Maccabi Frankfurt zu Gast. Oben stehen Zwanziger und Nationalspieler mit
fremden Vorfahren als Vorbilder für eine humane Gesellschaft; sollte
man ein paar Etagen tiefer sein, in den Amateurligen, sind Antisemitismus
und Rassismus so sicher wie die Blutgrätsche.
Wenn es die Schule nicht schafft, Jugendliche über den Nationalsozialismus
und dessen Verbrechen zu unterrichten, dann muss der Fussball als Mittler
einspringen. Dies ist ein Motiv der „forschenden Fans“. Auf eigne
Kosten durchforsten sie Archive, reisen und befragen die letzten Zeitzeugen.
Markwart Herzog erkundete die Geschichte des 1. FC Kaiserslautern. Das grosse
Interesse am Idol Fritz Walter ermöglichte es ihm, der Öffentlichkeit
einen mutigen Mann vorzustellen: Den ehemaligen Präsidenten Ludwig Müller,
der unterm Faschismus den Kontakt zu seinen Sportkameraden jüdischer
Abkunft aufrecht erhielt und sein Verhalten vor Gericht verteidigte.
Schlecht ausgebildet und noch schlechter bezahlt steht der Wachmann vor dem
Supermarkt. Als Ausgleich trägt er Uniform und jagt Betrunkene, denen
Geld fehlt, um im Restaurant auf Spesen zu saufen, davon. Dass der Beruf Ausflüge
in solch soldatisches Befehlen gestattet, zieht Rechte zu den privaten Sicherheitsdiensten.
Viele Vereine wissen gar nicht, wen sie sich da auf den Rasen holen. Blaschke
erzählt davon, wie langsam das Gewaltmonopol des Staates auf den Sportplätzen
und in den Innenstädten zerbröckelt und macht so anschaulich dass
Fussball nur ein Beispiel unter vielen ist, wie die Rechte klammheimlich das
politische Vorfeld besetzt. Der populäre Fussball dient als Beispiel
wie etwas weitgehend unbeachtetes geschieht. Das langsame Abdriften der Alltagskultur
nach rechts. Darum schaute sich Blaschke auch Comics und Kleidermarken an
und war auf Rechtsrockkonzerten unterwegs.
Aktuell bevorzugt die Rechte, was dem Fussball ja angemessen ist, die Graswurzelarbeit
statt den inszenierten Medienskandal. In Kaiserslautern agierte sie, wie Blaschke
es zuvor anderorts beobachtet hatte. Zum Länderspiel Deutschland –
Kasachstan auf dem „Betze“ wollte die NPD mit Bundesvorsitzenden
und ihrem Spruch „Weiss ist mehr als eine Trikotfarbe“ aufmarschieren.
Es wurde ihr verboten. Beim Heimspiel gegen den als links geltenden FC St.
Pauli demonstrierte sie ungehindert. Als keine Kamera zu befürchten war,
lud der ASV Kaiserslautern die Rechtsrocker der „Kategorie C“
auf´s Gelände ein. Musik und Fussball lockten schwankende, anpolitisierte
Jugendliche. Die erste Begegnung mit einem Nazi fand in einer angenehmen Festivalstimmung
mit Bier und Bands, noch dazu mit dem abenteuerlichen Hauch des Verpönten,
der Gratisrebellion statt. Für diese Art der Verführung gab sich
der ASV her. Genau wie Blaschke schreibt: „Rechtsextremismus findet
meist im Verborgenen statt, das macht ihn für den Fußball so gefährlich.
Deswegen muss man immer wieder darüber berichten.”
Ronny Blaschke, Angriff von Rechtsaußen, Verlag Die Werkstatt, Göttingen
2011, 224 Seiten, 16,90 Euro, ISBN 978-3-89533-771-0
Dem
Kapitalismus die Reisszähne ziehen -
So
vielleicht Frau Wagenknecht ?
31. Oktober 2011
„Freiheit statt Kapitalismus“ Eichborn Verlag -
Buchvorstellung
von Stefan Gleser
Das neue Buch der Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht heisst „Freiheit
statt Kapitalismus“. Der Name ist nicht nur Spott auf eine ehemalige
Wahlparole der CDU. Freiheit bedeutet nach Ferdinand Hardekopf zuerst befreit
sein, frei von Arbeitslosigkeit, fehlender gesundheitlicher Versorgung, Bildungsnotstand
und Wohnungselend. Aber genau diese Dinge produziert der „alte, kranke“,
am Tropf des Steuerzahlers hängende Kapitalismus, der nichts mehr erfindet,
sondern nur noch vererbte Privilegien verteidigt, täglich im Überfluss.
Wagenknechts Adressat ist der Teil des Bürgertums, der nicht im Kopftuchmädchen
den Grund für seinen Absturz sieht. Wagenknecht will keine Linke bestätigen,
sondern den FDPler überzeugen, dem´s allmählich merkwürdig
vorkommt, dass mittelständische Betriebe den Bach heruntergehen, während
einer Bank, die behauptet, sie sei systemrelevant, Geld nachgeworfen wird.
Deshalb verwendet Wagenknecht keine marxistischen Termini, zitiert keine
Klassiker, lehnt die ehemalige Sowjetunion ab und beruft sich auf Verfechter
der „sozialen Marktwirtschaft“ wie Ludwig Erhard. Damit entspricht
sie der Verklärungssucht vieler Menschen, die sich an die Zeit erinnern,
als geregelte Arbeitsverhältnisse noch als Norm galten. Wahrscheinlich
waren die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts keine Benefizveranstaltung
„ordoliberaler“ Menschenfreunde. Der Kommunismus drohte, Fabrikbesitzer
taten gut daran, sich verbal zu mässigen, Sozialdemokraten und DGB forderten
soziale Rechte statt Reformen und den Westalliierten war die Stahlindustrie
nicht geheuer und zähmten sie durch die Montanindustrie. Wagenknecht
sieht einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Verfall der Sowjetmacht und
der Kriegserklärung an die arbeitenden Menschen, aber keinen ursächlichen
In der Beschreibung des Ist-Zustandes dürften ihr nur wenige widersprechen:
Das Elend der „Hartz-IV-Hölle“, Bildung und Rente sind auf
den Hund gekommen und die Städte verwahrlost. Ein Millionär braucht
keine öffentliche Bibliothek. Die Welt der Güter und Dienstleistungen
rottet vor sich hin, und für Bankeigentümer blüht der Sozialismus.
Keine „persönliche Haftung“ (Walter Eucken), kein Unternehmensrisiko.
Wagenknecht lässt den gutbürgerlichen Journalisten Roger de Weck
es so zusammenfassen: „Die über 1 Billion Euro, die zwischen 2007
und 2010 in die Bankenrettung gesteckt wurden, bedeuten die Übertragung
von 1 Billion Euro fauler privater Schulden auf die öffentliche Hand.“
Die Banken hemmen den Wirtschaftskreislauf. Ihrer Aufgabe, Geld Kredite für
Neuanschaffungen und Erfindungen zur Verfügung zu stellen, brauchen sie
nicht mehr nachzukommen, da sich mit Kreditverbriefungen gefahrlos wesentlich
mehr verdienen lässt.
Deshalb schlägt Wagenknecht die Überführung des Versicherungs-
und Finanzsektors in gesellschaftliches Eigentum vor. Um wieder Leistungsanreize
zu schaffen, muss die Erbschaftssteuer erhöht werden. Wenn das Leben
schon ein Wettkampf aller gegen aller sein soll, dann dürfte es doch
unter fairen Sportsleuten keinen Zweifel geben, dass, wie Alfred Polgar schreibt,
die Startbedingungen für alle gleich sein müssten. Weiter setzt
sich Wagenknecht für Belegschaftsaktien ein. Was der Mensch unbedingt
braucht, was für das Zusammenleben nötig ist, soll nicht mehr privaten
Gewinninteresse unterworfen sein. Wasser und Bildung, sozialer Wohnungsbau,
Kommunikation und Energie erklärt Wagenknecht für „eigentumsunfähig“.
Wagenknecht erklärt das mit einem historischen Beispiel. Die Abschaffung
der Sklaverei bedeutete, dass der Mensch nicht mehr das Eigentum eines anderen
war, er wurde eigentumsunfähig. Und so wie uns heute die Sklaverei als
unverständlich vorkommt, so sollen künftig Medizin oder Ausbildung
unabhängig von der Rendite werden. Wagenknecht schwebt ein buntgemischtes
Wirtschaftssystem mit sozialisierten Grossfirmen, Genossenschaften und vielen
innovativen Klein- und Mittelbetrieben vor.
Wer soll das alles ändern? Wer macht dem Wolf Appetit auf Grießbrei?
Die gegenwärtigen Proteste sind ohne Parteien und Gewerkschaften entstanden.
Man sitzt nicht ungestraft jahrelang mit Sarrazin an einem Kabinettstisch.
Seit Jahren sucht der Mittelstand nach dem Erlöser von Insolvenz, Zwangsversteigerung
und Abstieg. Von Schill über die FDP und Sarrazin, dann von den Grünen
über die Piraten zu Occupy wechselt der Heilsbringer immer schneller.
In diesem kalten Fieber ist es Wagenknechts Verdienst, dem Kapital das Definitionsmonopol
über Leistung und Wettbewerb zu nehmen.
„Freiheit statt Kapitalismus“ ist ein geschickt formuliertes
Angebot zur Volksfront an das aufgeklärte Bürgertum.
Sahra Wagenknecht 2011: Freiheit statt Kapitalismus. Eichborn , Frankfurt
2011,
ISBN: 9783821865461. 368 Seiten. 19.95 Euro.
6.10.2011 - Das
Leben als Online-Inszenierung
Dieter
Paul Rudolph schreibt i-n „Pixity -Stadt der Unsichtbaren“ über
den Offenbarungswahn im Internet. Buchvorstellung von Stefan Gleser
Es hat was für sich mit dem Auto ins Büro, wo man zur Geschäftsleitung
gehört, zu brettern. Nils Bentner, beinahe noch jung, kompetent,
innovativ, wie er in den Stellenannoncen steht, verdankt den
plötzlichen Aufstieg einer Eingebung: Pixity einer virtuellen Stadt für
knospende Jugendliche. Hier kann man gemeinsam lernen, Freunde finden
und sich einfach mal ausquatschen. Pixity hat Gästehäuser, Schulen,
Schwimmbad und Cafés. Und vor allen hat es nicht: Lehrer, Eltern, gar
Sozialarbeiter, die sich einmischen. Entdecke dein selbst, zeige dich so
wie du wirklich bist und tauche ein in die Welten der Pixity-Community.
Auf Pixity sind wir alle unheimlich nett und sprechen offen
miteinander. Es brummen die Zugriffszahlen. Bald gibt´s eine eigne
Währung. Damit kann man seine animierte Figur mit coolen Klamotten
behängen, in der Eisdiele abschlaffen oder ganz krass sein eignes Zimmer
mit Designermöbeln kreieren. Der Pixity-Dollar ist bestimmender als
jedes Gespräch und die Werbeindustrie berauscht sich an den perfekt
zugeschnittenen Kundenprofilen.
Vielleicht stärkte die weggelaufene Freundin Bentners Feingefühl.
Er
merkt wie sich die Gründungsmitglieder der „PixBiz“ langsam,
langsam
ändern. Mit mildem Spott standen sie früher dem Blabla der Werbung
und
der Pädagogik gegenüber. Es war eine Möglichkeit Staatsknete
und
Anzeigen abzugreifen. Jetzt da der Jargon zum Dukatenesel mutiert, wird
er ernst genommen. Alina Marschall, deren Aufgabe es ist, Werbeaufträge
ins wirklich wertvoll Erzieherische zu übersetzen, nennt plötzlich
eine
Farb- und Stilberaterin ihr eigen und erscheint in
Wildlederkänguruhstiefel zur Arbeit. Wenn man meint, Gast in einem
Bionadevideo zu sein, gibt es dann noch etwas zum Festhalten?
Ja, der Schnaps an der Theke des Taco´s. Der Wirt Rigo vereint
Geschäftssinn und Humanität und spuckt Gästen, die vom Arbeitslager
schwärmen, „gekonnt“ und „diskret“ in die Gläser.
Den Abend besäuselt
damit zu verbringen, das verlegen subversive Beginnen von „Pixbiz“
zu
verklären, wäre für Bentner durchaus angenehm, würde nicht
in einer Ecke
der Kneipe Hans-Jürgen Gorland drohen. Dieser war Grafiker des
Gründungsteams und erfüllte seine Pflicht als sensibler Künstler.
„Ihr
macht die Kids zur blossen Profitmasse“, hatte er in einer der
wöchentlichen Versammlung losgepoltert, prophezeite ein digitales Puff
und liess sich auszahlen. Jetzt träumt er vom Malerleben unter des
Südens Sonne, kann aber nicht weg, weil seine Ex noch Geld will und das
sickert ständig durch seine Finger. Versumpfen im Taco ist auch keine
Lösung.
Bentner trottet den goldnen Mittelweg entlang. Er steigt nicht aus,
lässt sich aber vom Posten des Chefprogrammierers wegloben und macht
sich auf die Jagd nach „Fakes“. Denn Lifestyle und Hochglanz verträgt
sich nicht mit schäbiger und schmutziger Anmache. Mit den „Fakes“
verhält es sich so. Altersfaltige, männliche Finger tippen
beispielsweise ins Textfeld sie seien ein junges Mädchen. Der Vorschlag
bei Liebeshändel, solle man sich verstellen ist alt und komisch. Zeus
als Schwan, der Heiratsschwindler, der Maskenball. Rudolph kippt die
Verwechslungskomödie ins düstere, ja zuweilen tragische. Denn es
geht
um Erpressung mittels Fotos. Die kann man so schön in unseren sozialen
Netzwerken hochladen und dann erfährt die Klasse, der erste
Jugendschwarm, die beste Freundin wirklich alles. Tu also lieber das,
was ich will.
Paul liegt nicht viel am Literaturbetrieb. Er schreibt wunderbar herzlos
und, wenn´s das Wort gibt, sensationsabstinent. Nehmen wir mal die Lisa.
Die ist Praktikantin bei „Pixbiz“, dafür zuständig unanständige
Wörter
auszusortieren und liebkost auf einzigartig betörende Weise den
Teppichboden mit ihren Füssen. Da möchte Bentner Perser sein. Die
Lisa
verdient also weniger als die Geschäftsführung. Mein Gott, welch
eine
Aufregung, welch ein Gedöns, wenn Wallraff nach knochenharter Recherche
rausgefunden hätte, dass es Praktikanten nicht so gut geht. Und was das
Lehrerzimmer dazu gesagt hätte!
Grau und trübe, in nicht fassbarer Bedrohlichkeit strömt aus dem
Rechner
der ewig gleiche elektronische Geruch, wenn Bentner nach unsittlichen
Offerten pirscht. Er begegnet dabei nicht nur „Pädobären“,
die einfach
zu fantasielos sind, die Badezimmertür zu schliessen und sich eine
junge Dame, so wie sie der „Playboy“ schuf , vorzustellen. Eine
merkwürdige, rätselhafte Anna, die etwas Unverständliches,
etwas vom
„goldenemBlut“ erzählt, schwirrt umher, klagt über Elternhaus
und
Schule und verbirgt sich hinter einem weiteren Nickname. In Bentner
mischt sich eigne Jugend mit dem Wunsch, Anna vor einer unbekannten
Gefahr zu bewahren
In „Pixity“ setzt sich die Sprache zur Wehr. Sie sammelt Unmengen
von
Umständlichkeit, springt in der Zeit umher und ist vollendet ungelenk.
So tritt sie gegen das bunte, rasend schnelle Monitorgestammel an.
Klar, dass sie den kürzeren zieht. Rudolph scheitert gelungen. Ich habe
noch nie was gelesen, dass so vorsätzlich auflagenmindernd vertrackt
einher kommt. Rudolph ist der bedächtige und umsichtige Aufzeichner des
permanenten Selbstdarstellungsrauschs in Zeiten von Casting, Talkshow
und Internet.
Weidenfeld, der Firmenbuchhalter, der mit Ärmelschonern zur Welt kam,
hat beim Pinkeln ein dringendes Bedürfnis. Er will unbedingt mit Bentner
sprechen. Ganz wichtig. Dann funkt das Handy dazwischen. Es muss
wirklich wichtig gewesen sein, denn wenig später läuft Weidenfeld
im
wahrsten Sinne des Wortes ins Messer.
Im Gegensatz zum konformen Kritikkrimi, sind es nicht Geheimdienste und
internationale Kinderschänderringe, liiert mit den Höchsten in
Wirtschaft und Politik, die das Internet böse und gefährlich machen
Rudolph kommt zu dem für uns wenig schmeichelhaften Ergebnis, dass wir
es sind, die Daten, von der Zigarrenbauchbindenpräferenz bis zum
Fickbegehr, brav abliefern.
Der Mörder, wie ihn Bentner unabhängig von der Polizei aufspürt,
ist
von einem rührenden Anachronismus besessen. Er glaubt noch an so etwas
wie Privatsphäre, noch an ein von der Öffentlichkeit autonomes Ich.
Ein
zutiefst akkurater Mensch, von geradezu wüster Ordnungsliebe, der die
Kinder der Verwandtschaft mit einer neuen Art der Nachhilfe beglücken
wollte.
Wenn es stimmt, was Sigmund Freud sagt, dass der Verlust der Scham das
erste Anzeichen des Schwachsinns sei und wenn es stimmt, was Rudolph
alles im Internet beobachtet hat, dann sind wir schon prächtig
verblödet.
Dieter Paul Rudolph
Pixity Stadt der Unsichtbaren
Conte , Saarbrücken, 2011
288 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-941657-29-8
Preis 13,90 €
Anhänge: