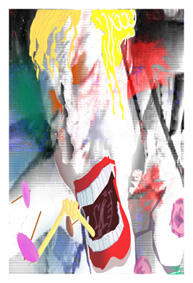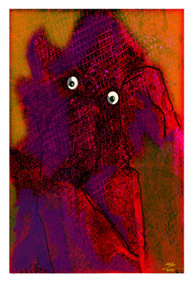Griechenland - Aktivitäten der Künstlergruppe Kolzo aus dem Jahr
2010 bis 2013
2011
Aktion der Künstlergruppe Kolzo vor der Frankfurter Börse
Bild ist keine Meinung - Bild ist ein Verbrechen Protestaktion in Wadgassen
Griechenland
und „die Griechen“ in der Bildzeitung
Der Beitrag „Griechenland und >die Griechen<
in der Bildzeitung“ von Reiner Diederich ist erstmals in der Zeitschrift
BIG
BUSINESS CRIME (Ausgaben 03/2015) erschienen. Mit freundlicher Genehmigung
des Autors übernehme ich ihn in meine "Bildraum-Machtraum - Die
Macht der Bilder, Bilder der Macht" Ausstellung/Auseinandersetzung. Die
Bilder zu diesem Beitrag sind Bilder der Künstlergruppe Kolzo, deren
Mitglied ich bin. Bernd Rausch, August 2019.
Im Vorwort einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebenen Studie von Stephan Kaufmann mit dem aus der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ vom 5. Februar 2015 zitierten Titel „Die Halbstarken von Athen“ heißt es: „In Deutschland herrscht die Meinung vor, Griechenland sei selbst schuld an seinem Elend: Erst habe sich das Land in die Euro-Zone gemogelt, dann habe die Regierung zu viel ausgegeben, und überhaupt hätten die Regierten zu wenig gearbeitet.“ (Kaufmann, S. 3) In der Studie werden diese gängigen Mythen über die Griechenland- und Euro-Krise anhand von Zahlen und Fakten widerlegt.
In den meisten deutschen Medien wurden sie mehr oder weniger stark seit langem
verbreitet und bei Bedarf heftig geschürt. Vor allem durch die Bildzeitung,
die als auflagenstärkste Tageszeitung und zudem als Vorbild und Leitmedium
zahlreicher anderer Presseorgane den größten Einfluss auf das Alltagsbewusstsein
der Bundesbürger ausübt. Wie das im Einzelnen geschieht, welche
Interessen dahinter stehen und welche Funktionen eine solche Stimmungsmache
hat, versuche ich nachfolgend darzustellen.
Eine Analyse und ihre Ergebnisse
2011 hat die Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall eine Analyse von Hans-Jürgen
Arlt und Wolfgang Storz über die Darstellung der Griechenland- und Euro-Krise
in der Bildzeitung veröffentlicht: „Drucksache ‚Bild‘
– Eine Marke und ihre Mägde“. In dieser Untersuchung wurden
zwar ausschließlich Artikel aus dem Jahr 2010, dem Beginn der Krise,
ausgewertet. Da sich an der verzerrten Optik der Bildzeitung seither jedoch
nichts geändert hat, sind die Ergebnisse unvermindert aktuell. Ihre damals
angelegte Kampagne gegen die „faulen Griechen“, denen kein weiteres
Geld aus der EU zufließen soll, weil sie ihre „Hausaufgaben“
nicht gemacht hätten (um einen von den deutschen Schulmeistern gegenüber
anderen europäischen Ländern gerne gebrauchten Begriff zu benutzen)
wurde inzwischen sogar verschärft und hat nach dem Wahlsieg von Syriza
geradezu hysterische Ausmaße angenommen.
Zunächst stellen Arlt und Storz klar, dass es sich bei dem Produkt Bildzeitung nicht um professionellen Journalismus handelt, wie man ihn traditionell von Presseerzeugnissen erwarten kann, sondern um eine Inszenierung, um ein „massenmediales Machwerk“, das sich als „Volkes Stimme“ ausgibt. Aus Fakten werden Fiktionen, mit Bildern garnierte Erzählungen in kurzen Sätzen, die auf eine immer gleiche Botschaft hinauslaufen. Damit mache sich die Bildzeitung selbst zum politischen Akteur, der Druck aufbaut, um Entscheidungen zu beeinflussen oder zu erzielen.
„Die ‚Bild‘-Zeitung ‚strickt‘ aus den Ereignissen und um das Thema herum eine Geschichte, die Geschichte von den faulen und betrügerischen Griechen, die an das Geld des deutschen Steuerzahlers wollen. Diese ‚Bild‘-Aufführung läuft von Ende Januar bis Ende Mai 2010 in fortwährend neuen Episoden und wird im Herbst mit einer Serie noch einmal aufgegriffen. Was diese Aufführung stört, bleibt entweder unberücksichtigt oder läuft am Rande mit, sofern es, wie die Finanzmarktspekulationen, dem Publikum aus anderen Quellen zu bekannt ist, um völlig ignoriert zu werden.“ (Arlt/Storz, S. 9)
Zur politischen Wirkung, die dabei erzielt wird, schreiben Arlt und Storz: „Die ‚Bild‘-Story bietet eine stereotype, d.h. nach dem Freund-Feind-Schema gestrickte einfache Deutung an, die populistische Empörung über die politisch Verantwortlichen mobilisiert und Politikverdrossenheit fördert. Politik wird als Zirkus dargestellt und anschließend angeklagt, sie sei nur Politzirkus. ‚Bild‘ macht sich auf eine Art und Weise zum Vormund der Frustrierten, die auch für deren Vermehrung sorgt.“ (Arlt/Storz, S. 10)
Damit arbeitet die Bildzeitung mehr oder weniger bewusst Bewegungen wie „Pegida“ oder „Protestparteien“ wie der AfD in die Hände, von denen sie sich dann nach Bedarf wieder distanzieren kann. Denn ihr feststellbares Hauptinteresse ist – außer dem Absatz einer möglichst hohen Auflage – die Stützung der CDU-geführten Regierung und der Kanzlerschaft Angela Merkels.
Techniken der Inszenierung, die von „Bild“ regelmäßig angewandt werden: „Um ihre Geschichte der Griechenland- und Eurokrise zu erzählen und ihre Kampagne zu fahren, benutzen die ‚Bild‘-Macher solche Methoden der öffentlichen Kommunikation, die geeignet sind, ein möglichst großes Publikum anzusprechen. Die Überschriften, Fotos und Texte personalisieren, dramatisieren, emotionalisieren und moralisieren. Die ‚Bild‘-Story wird als Unterhaltungsprogramm präsentiert, das teils mit witzigen und frechen Einfällen, teils mit Elementen der Spannung und Bedrohung spielt. Mit Wundertüten in der Geisterbahn – so muss sich das Publikum fühlen, wenn es sich von ‚Bild‘ durch die Griechenland- und Eurokrise führen lässt.“ (Arlt/Storz, S. 10)
Die Ingredienzen ihrer Story hat die Bildzeitung nicht erfunden. Sie entsprechen dem, was im gesellschaftlichen Mainstream, auch in sogenannten Qualitätsmedien, über Griechenland und die Krise gedacht und geschrieben worden ist: Die Griechen hätten „über ihre Verhältnisse gelebt“, sich seinerzeit den Beitritt zur Eurozone mit falschen Zahlen ermöglicht und wollten nun immer neue Kredite ohne fassbare Gegenleistung. Griechenland solle lieber die Drachme wieder einführen, statt weiter seine europäischen Partner, vor allem Deutschland, zu belasten. Das ist auch die Meinung einflussreicher deutscher Ökonomen, an der Spitze Prof. Hans-Werner Sinn, den die Bildzeitung gerne als Experten zitiert.
„Bild“ verstärkt nur dieses Deutungsmuster und spitzt es auf die Forderung zu: „Kein deutsches Steuergeld für Griechenland!“ Dabei scheut die Zeitung auch vor dem primitivsten sprachlichen Kalauer nicht zurück: Die Griechen sollen nichts mehr kriegen – sprich: „griechen“. Kein Vergleich zu 2004, wo „Bild“ noch den Gewinn der Europameisterschaft durch die griechische Nationalmannschaft feierte, vor allem auch, weil sie einen deutschen Trainer hatte. Aus Otto Rehhagel machte sie damals auf der Titelseite den Ehren-Griechen „Rehakles“.
Dass die Bildzeitung 2010 mit ihrer Kampagne (zunächst) keinen Erfolg hat, hindert sie nicht daran, im Herbst dieses Jahres eine fünfteilige, jeweils fast ganzseitige Serie zu bringen: „BILD enthüllt! Die Euro-Lüge. So haben uns die Griechen reingelegt.“ Es versteht sich, dass die Interessen Deutschlands und anderer EU-Mitglieder bei der Aufnahme Griechenlands in die Eurozone, die Rolle beispielsweise von Goldman Sachs oder der Deutschen Bank bei der Schönung von Zahlen und bei der späteren Speisung der griechischen Kreditblase in dieser Serie verschwiegen oder klein geschrieben werden. Hat man doch einen Sündenbock, auf den man bequem und ohne Furcht vor Folgen einschlagen kann, weil er schwach ist und bereits am Boden liegt. Ihm geschieht recht, weil er „uns“ betrogen hat.
Der Wirtschaftskrimi um Griechenland wird entsprechend einem B-Movie einfachster Machart konstruiert: „Es ist eine Geschichte von Tricksen und Täuschen, von immer neuem Weggucken und skandalöser Wurstigkeit… Überall das Muster eines Krimis: Es gab das Motiv, es gab die Gelegenheit, es gab die Mittel.“ (Arlt/Storz, S. 22) Im Krimi muss es immer einen oder mehrere Täter geben, deren Entlarvung und Festnahme dazu dient, dass alles so weitergehen und alle so weitermachen können wie bisher. Wer sind die Schuldigen in diesem Fall? Es sind selbstverständlich die Griechen selbst.
„Wer ist schuld an der Krise?“, fragt die Bildzeitung am 12. Februar 2010. Da die Antwort darauf keinesfalls lauten darf: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem in seiner neoliberalen Variante“ oder: „Eine die Ungleichheiten in der Euro-Zone verschärfende Wirtschafts- und Finanzpolitik“ oder gar: „Die deutsche Hegemonie über Europa“, antwortet sie auf die selbst gestellte Frage wie aus der Pistole geschossen: „Griechenland!“ Mit einem Ausrufezeichen, das sich jeden Zweifel verbittet.
Aber Griechenland ist nicht nur an der Krise schuld, sondern noch dazu moralisch ziemlich verdorben: „In der Ausgabe vom 1. Februar (2010) erscheint ein vierspaltiger Artikel über Korruption in Griechenland. Die Headline: ‚Korruption! Ohne Schmiergeld läuft in Griechenland fast gar nichts mehr‘. Es wird in Großbuchstaben die Frage gestellt, ob ‚neue Milliarden‘ überhaupt helfen können, denn ‚Griechenland versinkt in der Korruption‘.“ (Arlt/Storz, S. 23)
Dass sich deutsche Firmen wie Siemens jahrelang mit Millionen an Schmiergeldern Großaufträge in Griechenland gesichert haben, interessiert „Bild“ hier nicht. Die unzweifelhafte Tatsache der verbreiteten Korruption in Griechenland wird dazu benutzt, um weitere „Hilfen“ abzulehnen, statt deren konkrete Formen zu problematisieren. Ganz nebenbei dient die Aufregung über korruptive Praktiken in anderen Ländern auch dazu, von der Wirtschaftskriminalität im eigenen Land abzulenken.
Die Externalisierung des „raffenden Kapitals“
Letztlich kann aber auch die Bildzeitung nicht verschweigen, dass die internationale
Finanzspekulation und die Manöver der Banken und der Ratingagenturen
bei der Griechenland- und Euro-Krise mit im Spiel sind. Sie kann ihre Leserinnen
und Leser auf die Dauer nicht für dümmer verkaufen, als sie sind.
Am 12. Mai 2010 lässt sie sich sogar zu der Wahrheit oder Binsenweisheit
hinreißen: „Die Gewinner des gigantischen Rettungspakets der EU
sind vor allem die Banken.“
Wie stellt sie es nun an, dass aus dieser Erkenntnis nichts weiter folgt? Arlt und Storz schreiben, dass auch in Kommentaren von „Bild“ die Spekulanten „scharf angesprochen“ werden: „Trotzdem: ‚Bild‘ spitzt in diesen Fragen immer wieder den Mund, pfeift aber für seine Verhältnisse leise. Keine Personalisierung, keine Zuspitzung, keine Dramatisierung, keine Attacken – gegen deutsche Banken und Unternehmen, gegen Ratingagenturen gleich gar nicht. ‚Bild‘ bleibt hier an ‚Bild‘-Maßstäben gemessen auffällig harmlos. Es wird einem allgemeinen, unspezifischen Unwohlsein Ausdruck verliehen. Und wenn es einmal etwas konkreter und härter wird – dann nur gegenüber ausländischen Banken.“ (Arlt/Storz, S. 28)
Das ist das ganze Geheimnis, das sich auch die Rechtspopulisten zunutze machen: Man unterscheidet zwischen inländischem und ausländischem Kapital. Man bewertet das einheimische Kapital eher positiv, weil es ja irgendwie „zu uns“ gehört – und das ausländische negativ, weil es „uns fremd“ ist und von außen eindringt. Wie zum Beispiel Heuschrecken – aber die sind längst schon wieder aus der Mode. Heute wird Klartext gesprochen: Das „angelsächsische Finanzkapital“ ist uns besonders fremd. Deshalb kommen die neuen Völkischen wie Jürgen Elsässer und andere darauf, dass wir uns seiner auch mit Unterstützung der ehrlichen deutschen Unternehmerschaft erwehren müssen. „Bild“ geht nicht so weit, aber es arbeitet der uralten und nach wie vor weit verbreiteten Unterscheidung zwischen angeblich „schaffendem“ und angeblich nur „raffenden“ (Geld-)Kapital zu, die einen einzigen Sinn hat: die Mechanismen der Kapitalverwertung zu vernebeln.
Zur Rolle von Stereotypen
Arlt und Storz zeigen, wie die Bildzeitung mit sozialen Stereotypen arbeitet,
um mit ihren Geschichten bei einem Massenpublikum anzukommen, das bereits
in diesen Stereotypen denkt und fühlt. In der Diskursforschung werden
solche Stereotype und ihre Kombination auch „Kollektivsymbole“ genannt.
Das Bild des angeblich „faulen Griechen“ ist ein derartiges Kollektivsymbol,
das von vielen, wenn nicht den meisten geteilt wird. Schon die Vorstellung
von „dem“ oder „den“ Griechen folgt stereotypen Mustern.
Die Bevölkerung eines ganzen Landes wird als nationales Kollektiv oder
gar als eine einzige Person imaginiert.
Es gehört zur Definition von Stereotypen, dass sie mit der Realität wenig oder nichts zu tun haben und durch rationale Argumente nicht zu widerlegen sind. Um nur an einem Beispiel zu zeigen, wie es sich wirklich verhält: „In Griechenland wird sehr viel gearbeitet. Die tatsächliche Wochenarbeitszeit – abzüglich Mittagspausen – lag vor der Krise laut Eurostat bei 44,3 Stunden, in Deutschland waren es 41 Stunden und im EU-Durchschnitt 41,7 Stunden. Die französische Bank Natixis kam für Deutschland auf eine Jahresarbeitszeit von durchschnittlich 1.390 Stunden, in Griechenland sind es 2.119 Stunden.“ (Kaufmann, S. 23)
Arlt/Storz benennen den Vorteil der Stereotypisierung für eine die Wirklichkeit verfälschende Erzählung: „Da sich die ‚Bild‘-Geschichte der Griechenland- und Eurokrise auf Stereotype stützt, kann die Darstellung nicht genauer und differenzierter auf Griechenland eingehen. Zwischen Politik und Bevölkerung, zwischen Regierung und Opposition, zwischen Verantwortlichen und Nichtverantwortlichen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Krisengewinnlern und Krisenverlierern, zwischen Arm und Reich zu differenzieren würde bedeuten, einen der Hauptdarsteller der Geschichte, ‚die Griechen‘, zu demontieren und für die vorgesehene Rolle unbrauchbar zu machen.“ (Arlt/Storz, S. 30)
Das schließt nicht aus, dass einzelne „bessere“ oder „noch schlimmere“ Griechen in der Bildzeitung vorgestellt werden. So hat sie einerseits eines Tages vermeldet, „die Griechen“ hätten Milliarden Euro in die Schweiz verschoben, um sie vor den – sowieso unter den Vorgängern der Regierung Tsipras äußerst ineffektiv arbeitenden – Finanzbehörden zu retten. Als ob tatsächlich alle Griechen bzw. jeder kleine Steuersünder dazu in der Lage gewesen wären. Andererseits hat „Bild“ zum Beispiel einen superreichen Reeder an den Pranger gestellt, der kaum Steuern zahlt – mit der rhetorischen Frage, ob der es wert sei, „von uns“ gerettet zu werden.
Ein Nebeneffekt der Rede von „den“ oder „dem“ Griechen ist es, wie schon in obigem Zitat angedeutet, dass zwischen „Arbeitnehmern“ und „Arbeitgebern“ – sprich: zwischen Kapital und Arbeit – nicht differenziert werden muss. Das ist aber nichts anderes als eine Stützung der Ideologie der Volksgemeinschaft, wie sie traditionell von den Parteien der Rechten bis hin zu den Faschisten vertreten wird. Wenn es „die“ Griechen gibt, gibt es auch „die“ Deutschen – und die Auseinandersetzung spielt sich nun zwischen nationalen Kollektiven ab, nicht etwa zwischen sozialen Klassen, nicht etwa zwischen Oben und Unten in der Gesellschaft.
Dazu Stephan Kaufmann: „Der alte Spruch ‚Die Grenze verläuft nicht zwischen Nationen, sondern zwischen oben und unten‘ gilt nach wie vor. Denn tatsächlich geht es in den Konflikten in Europa nicht um ‚Griechenland gegen Deutschland‘ oder ‚Italien gegen Niederlande‘ etc. Es geht um ‚Arm gegen Reich‘, um ‚Lohnabhängige gegen Kapitalbesitzer‘ – also darum, dass die Ausgaben des Staates die Kapitalbesitzer unterstützen sollen, statt soziale Maßnahmen zu finanzieren. Die normale Bevölkerung soll billiger werden, sparen, auf Lohn verzichten, mehr arbeiten, wettbewerbsfähiger werden um Investitionen in Europa rentabler zu machen. Die ‚Euro-Rettung‘ ist darauf angelegt, Investitionsrenditen zu erhöhen. Dafür müssen die einen zahlen und arbeiten, die anderen kassieren. Und das in jedem einzelnen Land.“ (Kaufmann, S. 10)
Für die reife Leistung, mit ihrer Serie „Geheimakte Griechenland“ dabei mitgeholfen zu haben, dass von diesen Tatsachen abgelenkt wird, bekam die Bildzeitung einen Preis für „exzellenten Wirtschaftsjournalismus“ von der Quandt-Stiftung. Juroren waren Roland Tichy, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, Helmut Reitze, Intendant des Hessischen Rundfunks und Stephan-Andreas Casdorff, Chefredakteur des Tagesspiegel. Was beweist, dass es zwischen „Qualitätsmedien“ und dem Boulevard längst keinen Graben mehr gibt, sondern eine solide Arbeitsteilung.
Warum hat die „Bild“-Kampagne so einen Erfolg?
Die Bildzeitung hat ihren Namen nicht etwa nur deshalb, weil sie viele Bilder
bringt, sondern weil sie welche in den Köpfen ihrer Leserinnen und Leser
erzeugt. Während die meisten Boulevardblätter Idyllen einer „heilen
Welt“ suggerieren, die ihren Konsumenten das Leben versüßen
sollen, ist die Bildzeitung auch aufs Unheil spezialisiert. Das sind nicht
nur die alltäglichen Katastrophen, die Unfälle und Krankheiten von
Prominenten, die Kriege und Horrorszenen aus ausgewählten Kampfzonen
der Welt. Gebracht werden auch visuelle und sprachliche Bilder von dem, was
angeblich die Ursache des Unheils ist.
Statt komplexe Erklärungen für wirtschaftliche Sachverhalte zu versuchen, ist es doch viel einfacher, „die Griechen“ für ihre Misere selbst verantwortlich zu machen. Das funktioniert auf dem Hintergrund bereits vorhandener Voreinstellungen und Vorurteile. So enthält das weit verbreitete kulturrassistische Bild von den „Südländern“ vor allem: Den Neid gegenüber denjenigen, die es sich unter blauem Himmel und heißer Sonne angeblich so wohlergehen lassen, wie man es im Urlaub dort selbst gerne hat oder hätte. Die falsche Vorstellung der Arbeitsamen kälterer Regionen, dass im Süden das „dolce far niente“, die tägliche ausgedehnte Siesta wichtiger sei als alles andere. Die Fantasie der braven Handwerker über das Händlervolk, das weniger durch Leistung als durch betrügerische Tricks, überhöhte Preise und geschicktes Feilschen zu seinem Geld kommt.
Typisch dafür ein Kommentar in der Bildzeitung vom 30. Januar 2010: „Für wen sollen wir Deutschen denn noch die (leere) Staatskasse öffnen…?“ Die Südländer müssten lernen, „dass vor der Siesta harte Arbeit – sprich: Eisernes Sparen – steht. Hilfe zur Selbsthilfe gerne – nicht zuletzt, weil der Urlaub bei euch so schön ist!“ (Arlt/Storz, S. 17)
Nach dem Regierungsantritt von Syriza kam die Kampagne gegen die angeblich nur fordernden Griechen neu in Fahrt. Zum ersten Mal in der EU wurde die herrschende neoliberale Austeritätspolitik von einem Mitgliedsstaat offen in Frage gestellt. Nicht nur die Bildzeitung überschlug sich in Häme und Beschimpfungen: „Das Wochenblatt Die Zeit nannte Ministerpräsident Alexis Tsipras einen Verführer, das Magazin Der Spiegel einen Geisterfahrer. Die griechische Regierung wolle ‚Europa ausnehmen wie eine Weihnachtsgans‘, war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen und die Bild-Zeitung wütete: ‚Die griechische Regierung ist ein Haufen durchgeknallter Polit-Anfänger. Ihr Grundsatz lautet: Wir wollen alles! Neues Geld und Schuldenschnitt. Sie bekommen gar nichts! Das hat der Rest Europas ihnen klargemacht. Andere Staaten haben sich krummgelegt – auch für die Griechen. Doch ihre Steuerzahler sind nicht mehr bereit, für die Handaufhalter in Athen auf ihren kleinen hart erarbeiteten Wohlstand zu verzichten.“ (Kaufmann, S. 4)
An diesen Behauptungen stimmt nichts. Die Steuerzahler haben bisher für die sogenannte „Hilfe“ an Griechenland noch keinen Cent gezahlt. Es handelt sich bei der „Hilfe“ um verzinste Kredite, die aus geliehenem Geld finanziert wurden und bisher etliche hundert Millionen Euro Zinsgewinne für den deutschen Staatssäckel abgeworfen haben. Nur über einen Bruchteil der „Hilfe“ konnten die griechischen Regierungen verfügen, der Rest diente zur Bankenrettung. Und „krummgelegt“ hat sich Griechenland wie kein anderer Staat in Europa, um die Sparauflagen der Troika zu erfüllen – nur mit dem Erfolg einer Verschärfung der eigenen Lage. Was klügeren Wirtschaftswissenschaftlern von vornherein klar war.
Und wenn durch einen Staatsbankrott Griechenlands Milliarden bei den Gläubigern abgeschrieben werden müssten, wenn auch die deutschen Steuerzahler für die Zeche aufkommen müssen, dann ist das in erster Linie die Folge der verfehlten Politik der Troika – jetzt genannt: die Institutionen (EU, EZB, IWF) – unter maßgeblichem Einfluss der Bundesregierung.
Die Sache mit den „arbeitslosen Einkommen“
Es gibt meiner Ansicht nach noch einen weiteren Erklärungsansatz dafür,
warum die „Bild“-Propaganda im Fall Griechenland so wirkungsvoll
war und ist. Dieser Ansatz greift etwas tiefer als die üblichen sozialpsychologischen
Erklärungen für das Entstehen und die Funktionsweise nationaler
Stereotypen. Deshalb soll er etwas ausführlicher dargestellt werden.
Den arbeitenden Menschen ist eine Abneigung gegen alle eigen, die nicht arbeiten, obwohl sie es – jedenfalls ihrer Vorstellung nach – tun könnten. Dies spielt bei der Ablehnung der angeblich „faulen Griechen“ vermutlich eine noch größere Rolle als das kulturrassistische Stereotyp. Dabei müsste sich diese Ablehnung doch eigentlich zuvörderst gegen diejenigen richten, die aus der Ausbeutung fremder Arbeitskraft ihren Profit ziehen oder ohne eigenes Verdienst Zinsen auf ihre Geldvermögen einstreichen. Warum geschieht das nicht?
Das Einkommen der Unternehmer oder – wie es in Umkehrung der tatsächlichen Verhältnisse heißt – der „Arbeitgeber“ ist ja weitgehend nicht durch deren eigene Arbeit erwirtschaftetes Einkommen. Dass es oft als Unternehmerlohn bezeichnet wird, soll nur verschleiern, dass es sich überwiegend um Gewinne handelt, denen keine von denen, die über sie verfügen können, erbrachte Leistung gegenübersteht.
Die Entlohnung für tatsächliche Unternehmertätigkeit, wenn es sich denn um tätige Unternehmer bzw. Manager handelt, nicht bloß um Aktionäre und Couponschneider, macht nur einen kleinen Teil dessen aus, was die abhängig Arbeitenden an Mehrwert schaffen und was als Gewinn von den Kapitalbesitzern angeeignet wird.
Und die Zinsen auf Vermögen sind ebenfalls kein Ergebnis eigener Arbeit der Vermögensbesitzer, sondern letzten Endes auch nur umverteilter Mehrwert aus der Ausbeutung fremder Arbeitskraft.
Diese an sich einfachen Grundtatsachen kapitalistischer Ökonomie sind vielen nicht bewusst oder sie werden bewusst verdrängt. Ihrer Erkenntnis steht vieles entgegen. Sie werden in der Schule nicht oder kaum vermittelt, von den Medien selten klar benannt und selbst von den Gewerkschaften, die sich auf die Forderung nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen konzentrieren, nicht ins Zentrum ihrer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit gestellt.
Das ist der Ansatzpunkt für eine geschickte Uminterpretation: Anstelle des nicht durch eigene Arbeit erwirtschafteten Einkommens der Unternehmer und Geldvermögensbesitzer, das noch dazu immer weniger besteuert wurde und wird, rücken die Bezieher von sozialen Transfereinkommen ins Blickfeld – bzw. sie werden mit aller Macht in den Blick gerückt. Angefangen von den Arbeitslosen, den Hartz IV-Empfängern, denen, die von Sozialhilfe leben, bis zu den Asylbewerbern, die auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind. Selbst die Renten und Pensionen werden seit dem Ende des 20. Jahrhunderts kritisch betrachtet – unter der Parole der „Generationengerechtigkeit“, die Fragen nach einer „gerechten“ Verteilung des gesamtgesellschaftlichen Reichtums gar nicht erst aufkommen lassen soll.
Diese „arbeitslosen“ Einkommen werden nicht nur in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung verkannt: Sie erscheinen als bloße Kosten, statt auf der anderen Seite ebenso als nachfragewirksamer Faktor im gesamtwirtschaftlichen Kreislauf, der die Konjunktur stützt. Sie werden auch in ihrer Berechtigung in Frage gestellt. Wollen da welche nicht arbeiten, ruhen sich da welche auf der „sozialen Hängematte“ aus, kommen da welche als Wirtschaftsflüchtlinge ins Land, um von dem „von uns“ hart erarbeiteten Wohlstand etwas abzuzwacken? Unterschwellig gilt immer noch die Maxime aus vor-sozialstaatlichen Zeiten: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und selbst wenn die Betreffenden arbeiten wollen, ist es nicht gut, weil sie „uns“ die Arbeitsplätze wegnehmen.
Verkehrte Welt
Dass die Verdrehung der Ausbeutungsverhältnisse inzwischen ziemlich gut
gelungen ist, sieht man unter anderem daran, dass laut Umfrageergebnissen
etwa ein Drittel der Bundesbürger als größtes aktuelles Problem
die Zahl der Asylbewerber empfindet. Dagegen halten nur 2 Prozent den endlich
gesetzlich eingeführten Mindestlohn für wichtig. Das antagonistische
Verhältnis von Kapital und Arbeit ist zwar in irgendeiner Form den meisten
bewusst, wenn sie gezielt danach gefragt werden. Als veränderbar sehen
es aber die wenigsten an. Auch das ist ein Grund dafür, dass der Unmut
über die Verhältnisse auf Ersatzgegner abgelenkt werden kann.
Obwohl eine Mehrheit der Bundesbürger die Einkommens- und Vermögensverteilung und das Steuersystem für ungerecht hält, führt das, wie man an der letzten Bundestagswahl wieder gesehen hat, nicht dazu, dass politische Mehrheiten für eine Änderung dieser Ungerechtigkeiten entstehen. Es ist offenbar hinreichend gelungen, die Verteilungsfrage sozialpsychologisch aus der vertikalen Achse (Oben – Mitte – Unten) in die Horizontale zu drehen („wir“ und „die“; Arbeitende/Nicht-Arbeitende; Inländer/Ausländer; „Deutsche“/“Griechen“).
Aufgabe der Bildzeitung als in der Bundesrepublik meistgelesenem populären Blatt ist es, bei der Umformulierung sozialer Tatsachen in eine den Unternehmern genehme Richtung mitzuhelfen. Das ist schon im ureigenen Interesse des Springer-Konzerns, für den in ganz besonderer Weise das jahrzehntealte Bonmot von Paul Sethe gilt, dass Pressefreiheit die Freiheit von ein paar Dutzend Verlegern ist, ihre Meinung zu verbreiten. Inzwischen sind es wegen der Kapitalkonzentration auch im Bereich der Medien noch weniger geworden.
Was macht die Bildzeitung, um die arbeitenden Menschen, die sie lesen, davon abzuhalten, sich für die leistungslosen Einkommen der deutschen Unternehmer und der Reichen zu interessieren? Sie fährt regelmäßige Kampagnen gegen „Sozialschmarotzer“, die sie, mit wenigen Ausnahmen, unter den kleinen Leuten findet – „Hartz IV-Betrüger“, „Einwanderer in die Sozialsysteme“, Arbeitsunwillige aller Couleur. Wenn denn einmal ein Unternehmer ins Blickfeld kommt, dann ist es ein besonders dreister Steuerhinterzieher oder anderer Wirtschaftskrimineller, den man zum Abschuss frei geben kann. Am besten ein ausländischer – wie z.B. die griechischen Oligarchen, die ihre Millionen am Fiskus vorbei in die Schweiz verschoben haben.
Zwei Fliegen mit einer Klappe kann die Bildzeitung schlagen, wenn die Arbeitsunwilligen sich auch noch im Ausland befinden und von dort aus „uns“ angeblich auf der Tasche liegen. Das ist etwas, was den Bild-Leserinnen und -Lesern nicht in den Kopf will, was sie nicht begreifen können: Deutschland als „Zahlmeister Europas“, als „Sozialamt der Welt“ – das darf nicht sein. Da hört die Gemütlichkeit auf und es beginnt der blanke Hass. Ein Hass, der sich nicht gegen die heimischen Beutelschneider, Gewinnbezieher und Superreichen richten kann und darf – auch weil das Zivilcourage erfordern würde oder Kampfgeist und vor allem Solidarität mit anderen.
Lieber richten allzu viele ihn – gemäß dem Motto: „Nach oben buckeln und nach unten treten“ – gegen solche, die man ohne eigenes Risiko diskriminieren kann und dafür noch Beifall in der Familie, unter Arbeitskollegen oder im Freundeskreis bekommt. Das ist auch das Erfolgsrezept rechtspopulistischer Strömungen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Solche Reaktionsweisen sind durch die jahrzehntelange Propagierung neoliberaler Welt- und Gesellschaftsbilder verstärkt worden. Das hat zu einer Fragmentierung der Gesellschaft, zu wachsendem Wohlstandschauvinismus und Sozialdarwinismus („Fressen oder gefressen werden“; „Jeder ist sich selbst der Nächste“) beigetragen. Auch die Ethnisierung sozialer und politischer Fragen ist eine Folge davon, wie an der medialen Verarbeitung der Krise der EU und des Euro zu beobachten ist. Neue, aus der Not oder besseren Einsicht geborene Initiativen und soziale Bewegungen stehen dem entgegen, sind aber noch schwach.
Zur letzten Bundestagswahl brachte die „Alternative für Deutschland“ ein Text-Plakat heraus: „Die Griechen leiden – Die Deutschen zahlen – Die Banken profitieren.“ Als ich damals einen AfD-Vertreter fragte, warum man dann nicht gemeinsame Sache machen könne: Griechen und Deutsche vereint gegen die Banken, verriet er mir das Betriebsgeheimnis seiner Partei und aller derartigen sozialdemagogischen Bestrebungen. Gegen die Banken könne man doch sowieso nichts machen. Also dann wenigstens die Griechen weiter leiden lassen, damit wir nicht noch mehr zahlen müssen – das sagte er nicht, aber das wäre die logische Konsequenz seines Denkens und einer solchen Propaganda.
Reiner Diederich war bis 2006 Professor für Soziologie und Politische Ökonomie am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt am Main. Sein Beitrag basiert auf einem Vortrag, den er am 17. Juni 2015 auf der Veranstaltung „Griechenland – ein Blickwechsel“ gehalten hat, die vom Institut für Migrationsstudien und interkulturelle Kommunikation an der FH Frankfurt organisiert worden ist.

Images Marcel Mack und Bernd Rausch, Künstlergrpe Kolzo